
Arzt-Patient-DiGA: Wie gelingt die Dreiecksbeziehung?
Sind Apps auf Rezept aus Perspektive der Ärzt:innen ein Fortschritt oder Fehlversuch? Wir haben Dr. med. Philipp Stachwitz um Antworten gebeten. Er verrät, wo sich die Welt der Medizin und Digitalisierung treffen können.
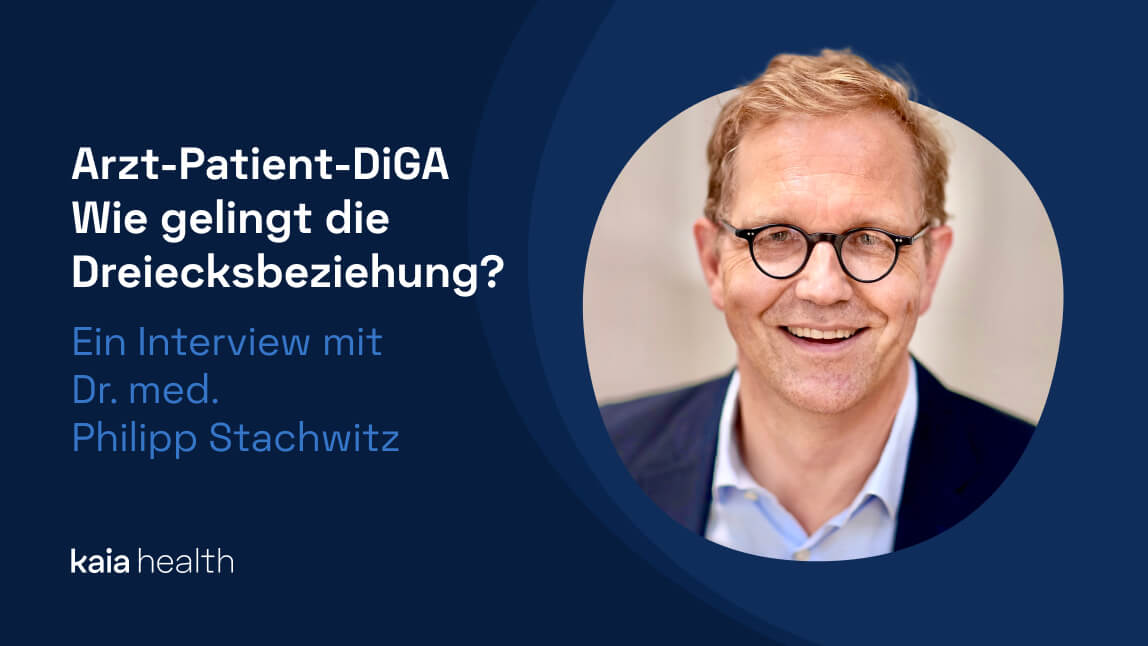

Als Facharzt für Anästhesiologie und Spezielle Schmerztherapie setzt sich Dr. Stachwitz schon seit Jahrzehnten für eine Digitalisierung der Medizin ein, die sowohl Patient:innen dienen als auch den Arbeitsalltag von Ärzt:innen erleichtern soll.
Bereits 2004 war er verantwortlich für die Stabsstelle Telematik der Bundesärztekammer und später auch bei der gematik (Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH) in beratender Funktion tätig.
Vom health innovation hub (hih) des Bundesministeriums für Gesundheit führte es ihn zur Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM), die er seit Anfang 2022 als Berater für Digitale Medizin unterstützt.
Weitere Artikel
-
 Am 15.11.2023 ist Welttag der COPD. Wir möchten Menschen mit Symptomen helfen, sich früher diagnostizieren zu lassen, um ein schnelles Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern und so die eigene Lebensqualität zu erhalt4 Min. Lesezeit
Am 15.11.2023 ist Welttag der COPD. Wir möchten Menschen mit Symptomen helfen, sich früher diagnostizieren zu lassen, um ein schnelles Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern und so die eigene Lebensqualität zu erhalt4 Min. Lesezeit -

Rückenschmerzen unterer Rücken: Ursachen, Symptome und Behandlung
Schmerzen im unteren Rücken sind die häufigste Form aller Rückenbeschwerden. Wir zeigen dir, woher sie kommen und wie du sie behandelst.12 Min. Lesezeit -

COPD: Die 3 wichtigsten Säulen einer wirksamen Therapie
Worauf kommt es bei der Behandlung von COPD an? Wir fassen die drei wichtigsten Elemente einer wirksamen Therapie zusammen.3 Min. Lesezeit
